 zurück
zurück
 Die
Alraune
Die
Alraune 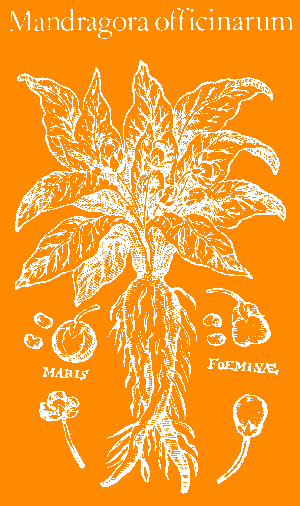
Die Alraune (Mandragora officinarum) zählt zu den bekanntesten zauberkräftigen Pflanzen. In ihrem deutschen Namen klingt das altnordische run (Geheimnis, Rune) an. Die Pflanze gehört zur Familie der Nachtschattengewächse. Sie enthält Hyoscyamin, Scopolamin und Atropin und kann in hohen Dosen beim Menschen Vergiftungen auslösen. Ihren Ruf verdankt die Alraune vor allem ihrem eigentümlichen, rübenartigen, gespaltenen Wurzelstock, der an einen menschlichen Torso mit zwei Beinen erinnert. Aus diesem Grund stellte man sich die Alraune belebt, als menschenähnliches Wesen vor.
Schaurige Berichte grassierten im Mittelalter:
Alraunen wüchsen vornehmlich unter den Galgen gehängter Diebe. Außerdem stoße
die Pflanze beim Herausziehen einen furchtbaren Schrei aus - wer ihn höre, sei
zum Tode verdammt.
Schaurige Berichte grassierten im Mittelalter: Die Alraunen wüchsen vornehmlich
unter dem Galgen aus dem Samen der gehängten Diebe. Außerdem stoße die Pflanze
beim Herausziehen einen furchtbaren Schrei aus. Wenn man sich die Ohren nicht
mit Wachs verstopfte, wäre der sofortige Tod die Folge. Den Schrei der Alraune
hat übrigens Shakespeare in "Romeo und Julia" literarisch verarbeitet. Kein
Wunder, dass Hildegard von Bingen (1098-1179) darum zur Ansicht neigte, der
Teufel selbst wohne in der Wurzel. Selbstverständlich war die Alraune auch ein
wichtiger Bestandteil der legendären Hexensalbe. Wegen ihrer Gefährlichkeit
musste der Besitzer einer Alraune sie irgendwann wieder loswerden. Starb er,
solange er noch im Besitz einer dieser Wurzeln war, kam er unweigerlich in die
Hölle.
Allerdings werden sich viele Eigentümer einer solchen Wurzel umsonst Sorgen
gemacht haben. Denn weil das Geschäft mit der magischen Wurzel blühte,
verkauften geschickte Fälscher häufig die runde Siegwurz (Gladiolus communis)
oder andere geeignete Wurzeln, die als "Alraunen" menschenähnlich
zurechtgeschnitzt wurden.
Die Mandragora kam als Abwehrzauber bei übersteigertem Sexualtrieb zum Einsatz.
Der Betroffene musste eine weibliche Alraune zwischen Brust und Nabel
befestigen. Die Wurzel wurde dann gespalten. Ein Teil verblieb am Körper, der
andere wurde mit Kampfer, einem durchblutungsfördernden Mittel, zerrieben und
eingenommen. Auch andere mächtige Pflanzen, wie etwa Engelwurz und Beifuß,
wurden häufig als Abwehrzauber eingesetzt.
Wie man in der Antike viele Hausgötter als
Statuetten an einem geheimen Ort aufbewahrte, so wurden auch Alraunwurzeln
bekleidet, gebadet, verehrt und in Kästchen oder Fläschchen verschlossen
verwahrt. Man richtete sie so her, dass sie wie Menschenkörper oder zumindest
wie Menschenköpfe aussahen. Der so fürsorglich behandelte Pflanzengeist sollte
seinem Besitzer Glück, Liebe, Reichtum und Gesundheit bringen.
In der Antike fand die Alraune, von deren Wurzel man einen Wein machte, als
Heilmittel gegen Epilepsie und Augenkrankheiten Verwendung. Zudem wurde sie als
Amulett und Talisman benutzt. Schon bei den Persern und Ägyptern galt die
Alraune als Aphrodisiakum. In Griechenland trug sie den Beinamen Kirkeia, da man
vermutete, die Zauberin Kirke habe sich die Männer mit Hilfe der Alraune gefügig
gemacht. Durch den hohen Anteil an Alkaloiden war der Genuss der Pflanze stets
gefährlich. Andererseits galt für die Alraune wie für andere magische Gewächse
auch: je größer die Gefahr, desto mächtiger der Zauber der Pflanze.
Das Ziehen einer Mandragora-Wurzel war ein gefährlicher Vorgang: Im Codex Anicia
Juliana in der Österreichischen Nationalbibliothek findet sich eine Abbildung
des
berühmten griechischen Arztes Dioscurides (1. Jh. n. Chr.), eines eifrigen
Sammlers pharmazeutisch wirksamer Pflanzen, der von der Göttin der
Erfindungskunst, Heuresis, eine Mandragora-Wurzel überreicht bekommt. Zu seinen
Füßen liegt ein verendeter Hund, den man vorher an die Pflanze gebunden hatte.
Als er weglaufen wollte, starb er auf magische Weise beim Ausreißen der Wurzel.
.
Den klassischen Bericht über das Sammeln der Alraune überlieferte der jüdische
Geschichtsschreiber Flavius Josephus (37-93 n. Chr.): Zunächst müsse die Pflanze
mit Urin und Blutfluss dazu gebracht werden, "stillzuhalten". Der Versuch,
selber die Alraune auszureißen könne mit dem Tod enden, wenn man die Wurzel
nicht vollständig aus der Erde bekomme. Deshalb trug man um die Pflanze
vorsichtig die Erde ab, band einen Hund daran, der dann beim Weglaufen die
Pflanze ausriss und als stellvertretendes Opfer starb.
Auch in China, wo die Alraune im 13. Jahrhundert durch reisende Moslems
verbreitet wurde, kennt man die Geschichte von der Mandragora-Ernte mit Hilfe
eines Hundes, der vom Gifthauch der Pflanze umkommt
Schaurige Berichte grassierten im Mittelalter: Die Alraunen wüchsen vornehmlich
unter dem Galgen aus dem Samen der gehängten Diebe. Außerdem stoße die Pflanze
beim Herausziehen einen furchtbaren Schrei aus. Wenn man sich die Ohren nicht
mit Wachs verstopfte, wäre der sofortige Tod die Folge. Den Schrei der Alraune
hat übrigens Shakespeare in "Romeo und Julia" literarisch verarbeitet. Kein
Wunder, dass Hildegard von Bingen (1098-1179) darum zur Ansicht neigte, der
Teufel selbst wohne in der Wurzel. Selbstverständlich war die Alraune auch ein
wichtiger Bestandteil der legendären Hexensalbe. Wegen ihrer Gefährlichkeit
musste der Besitzer einer Alraune sie irgendwann wieder loswerden. Starb er,
solange er noch im Besitz einer dieser Wurzeln war, kam er unweigerlich in die
Hölle.
Allerdings werden sich viele Eigentümer einer solchen Wurzel umsonst Sorgen
gemacht haben. Denn weil das Geschäft mit der magischen Wurzel blühte,
verkauften geschickte Fälscher häufig die runde Siegwurz (Gladiolus communis)
oder andere geeignete Wurzeln, die als "Alraunen" menschenähnlich
zurechtgeschnitzt wurden.
Die Mandragora kam als Abwehrzauber bei übersteigertem Sexualtrieb zum Einsatz.
Der Betroffene musste eine weibliche Alraune zwischen Brust und Nabel
befestigen. Die Wurzel wurde dann gespalten. Ein Teil verblieb am Körper, der
andere wurde mit Kampfer, einem durchblutungsfördernden Mittel, zerrieben und
eingenommen. Auch andere mächtige Pflanzen, wie etwa Engelwurz und Beifuß,
wurden häufig als Abwehrzauber eingesetzt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Die Mistel
Die Mistel
höchstem Ansehen stand die Mistel bei den Kelten, wenn sie auf
deren heiligstem Baum, der Wintereiche, wuchs.
Die auf Bäumen und Sträuchern schmarotzende Mistel hat einen vielfach gabelig
verzweigten Stamm, lederartige immergrüne Blätter und weiße Beeren. Die im
Zauberglauben bekannteste Spezies ist die auf Eichen wachsende Mistel. Generell galt die Mistel
als "allesheilend". Sie wurde von den Kelten unter rituellen
Vorkehrungen an bestimmten Tagen von den Bäumen geholt.
Interessant in diesem Zusammenhang: Stammte eine Mistel nicht von einer
Wintereiche, wurde sie als weniger stark in ihrer Heilwirkung
angesehen.
Wie für alle Pflanzen galt eine Analogie für die medizinische Wirksamkeit der
Mistel. Sie wurde vor allem bei der Fallsucht (Epilepsie) sehr geschätzt: Die
Mistel fällt nicht vom Baum, also fällt auch der Patient nicht, der sie bei sich
trägt oder in gekochtem Zustand zu sich nimmt. Man vermutete, dass bereits König
David diese Wirkung entdeckt hatte.
Gegen
Hexen und böse Geister hängt man die Pflanze im Stall und im Haus auf. In ganz
Europa ist der Glaube verbreitet, dass an der Türschwelle oder unter das Dach
gesteckte Mistelzweige als Abwehrmittel gegen schädigende Einflüsse wirke.
Besonders in England und Frankreich gilt die Mistel als Glückspflanze, wie der
englische Spruch nahe legt: "No mistletoe, no luck" (kein Mistelzweig, kein
Glück).
Hochgeschätzt wurde die Mistel bereits von den
Kelten und Germanen. In der germanischen Mythologie ist es ausgerechnet die
Mistel, eine eher unscheinbare Pflanze, die den unbesiegbaren Götterliebling,
den altgermanischen Lichtgott Baldur, tötet. Im Mittelalter kam sie in den Ruf,
Dämonen und Hexen abwehren zu können. So war man beispielsweise der Überzeugung,
man könne eine Hexe, die für einen Wetterzauber auf einen Baum geklettert war,
mit Hilfe von Misteln bannen. Dazu müsse man lediglich Misteln rings um den Baum
legen. Daraufhin ändere sich das magisch erzeugte Wetter.
Plinius d. Ä. (23-79) schreibt schon in der Antike von der Mistelverehrung der
keltischen Gallier. Die Druiden, gallische Priester, würden nichts Heiligeres
als die Mistel kennen. Am sechsten Tag nach Neumond bringt der Druide unter dem
Baum Opfer dar. Mit seiner goldenen Sichel schneidet er die Mistel vom Baum und
fängt sie in seinem weißen Mantel auf. Im Anschluss daran werden Tieropfer
dargebracht. Die Gallier glaubten, so Plinius, dass die Mistel, in einen Trank
gemischt, unfruchtbare Tiere fruchtbar mache und ein Allheilmittel gegen alle
Gifte sei. Tatsächlich wurde in der Antike bei Viehseuchen den Tieren ein Gebräu
aus Misteln in die Nase eingeflößt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Cannabis
Cannabis
Man nennt sie "Pflanzen der Götter" oder "Fleisch
Gottes" - Pflanzen, deren Einnahme Rauschzustände und Halluzinationen
hervorrufen. Schamanen aller Kulturen verwenden sie, um mit der Welt jenseits
unserer alltäglichen Erfahrung in Kontakt zu treten, um Visionen zu erlangen,
Flugerfahrungen hervorzurufen, die Zukunft zu ergründen oder Kranke zu heilen.
Eine der bekanntesten unter diesen Pflanzen ist sicherlich Cannabis - der Nektar
der Verzückung.
Eine alte indische Legende erzählt, dass die Dämonen und Götter auf den Rat
Vishnus mit dem Berg Mandara den Ur-Ozean umrührten, um den Trank der
Unsterblichkeit zu gewinnen. Vishnu selbst, in Gestalt einer Schildkröte, trug
dabei den Weltenberg auf dem Rücken. Götter und Dämonen wickelten die Schlange
Vasuki um den Berg und quirlten dadurch das Wasser schaumig. Dabei verlor die
Schildkröte einige Haare, die mit der Strömung ans Ufer trieben. Aus den Haaren
entstanden Pflanzen, darunter auch der Hanf (Cannabis sativa).
Anderen Legende zufolge war es der Gott Shiva, der den Menschen Cannabis
brachte.
So verwundert es nicht, dass indische Sadhus, die der Welt entsagt haben und dem
spirituellen Weg folgen, traditionell Cannabis rauchen - für sie eine
Möglichkeit, eine harmonische Beziehung zum Unendlichen herzustellen.
Bereits 2737 v. Chr wurde der therapeutische Wert von Cannabis in einem
chinesischen pharmazeutischen Traktat erwähnt.
Im Hochland von Tibet und im Himalayagebiet erlangten Cannabis-Präparate unter
dem Einfluss des Mahayana-Buddhismus große religiöse Bedeutung.
Auch Buddha soll sich bei seinem Weg zur Erleuchtung von Hanfsamen ernährt
haben.
Vor mehr als 2500 Jahren hatte der Hanf auch das Abendland erreicht.
Herodot (ca. 485-425 v. Chr.) berichtet von seinem rituellen Gebrauch bei den
Skythen.
Kein Zweifel besteht, dass Hanf zu medizinischen Zwecken seit ältesten Zeiten
verwendet wurde. Von Demokrit (ca. 470/60-380 v. Chr.) wissen wir, dass eine
Mixtur mit Cannabis bei gemischt wurde, um Visionen hervorzurufen.
Seit ältester Zeit wurde in China eine Mischung aus dem Harz des Hanfes mit Wein
als schmerzlinderndes Mittel bei Operationen verabreicht.
In Indien schrieb man Hanf die Fähigkeit zu, das Leben zu verlängern, die Ruhr
zu heilen und Fieber zu senken. Darüber hinaus sollte die Pflanze den Geist
beleben und das Urteilsvermögen verbessern. So belegen medizinischen Werken aus
dem 15. Jahrhundert, dass Hanf in Indien bei den unterschiedlichsten Beschwerden
verschrieben wurde.
Von Asien aus verbreitete sich die medizinische Anwendung von Cannabis rasch
nach Europa und Afrika.
Die Hottentotten verwenden es heute noch gegen Schlangenbisse.
In Europa des Mittelalters galt der Hanf offenbar nur als Heilmittel, nicht als
Halluzinogen. Man kultivierte je nach der Art der Beschwerden zwei Qualitäten
von Hanfpflanzen.
Die psychoaktiven Wirkstoffe sind bei den meisten halluzinogenen Pflanzen
Alkaloide, bei Cannabis hingegen ölige Verbindungen aus der Stoffgruppe der
Cannabioniden. Hauptverantwortlich für die psychedelische Wirkung ist das THC (Tetrahydrocannabinol).
Im Harz der weiblichen Blütenstände findet sich die größte Konzentration des
Stoffes.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Erythroxylon coca
Erythroxylon coca
Die Koka-Pflanze (Erythroxylon coca) gilt den
Andenvölkern seit Urzeiten als heilig. Sie untersteht der mythischen Mama Coca,
einer verführerischen Frau. Als die Indianer christianisiert wurden, änderte
sich an der Verehrung dieser Pflanzengöttin nichts. Sie wurde lediglich mit der
Jungfrau Maria identifiziert: Nach der Überlieferung der Indios hat Maria auf
ihrer Flucht nach Ägypten unter einem Koka-Strauch Rast gemacht. Entkräftet
pflückte sie einige Blätter und kaute an ihnen. Sofort fühlte sie sich angeregt
und kräftig und konnte ihre beschwerliche Reise fortsetzen.
Als leistungssteigerndes Mittel steht deshalb Koka in höchstem Ansehen. Außerdem
vermag die Pflanze das Hungergefühl zu vertreiben. Deshalb ist es Brauch, von
morgens bis abends die kleinen Kokablätter mit Quinoa-Asche oder Muschelkalk zu
kauen, um die wirksamen Bestandteile zu lösen.
Bei der Anwendung der Kokablätter mussten strenge
Regeln befolgt werden. Hielt man sie ein, konnte die Pflanze zu einem wichtigen
Heilmittel werden.
Die Inka behandelten zahlreiche Krankheiten mit der Pflanze, von Magengeschwüren
bis zur Höhenkrankheit und Impotenz. Man kannte auch die lokalanästhetische
Wirkung und setzte Koka deshalb bei Operationen ein.
Die Bedeutung, die Koka bereits in alter Zeit bei den Andenvölkern hatte, zeigt
sich in präkolumbianischen Tonfiguren, auf denen Schamanen - ausgewiesen durch
das Krafttier, den Jaguar - als Kokaesser mit dem charakteristischen Beutel für
die Kokablätter dargestellt wurden.
Das Kauen von Kokablättern stand beim rituellen
Gebrauch der Pflanze allerdings nicht im Vordergrund, zumal sich daraus keine
halluzinogene Wirkung ergibt. Die Blätter wurden vielmehr für ein rituelles
Orakel benutzt, das auch heute noch unter den Heilern und Schamanen in den Anden
weit verbreitet ist.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die spirituelle Fortentwicklung des Menschen steht
in China traditionell eng mit der Medizin in Zusammenhang. Geistiges Wachstum
ist nach chinesischem Verständnis nur dann zu erreichen, wenn es mit
körperlicher Vervollkommnung in Verbindung steht. Im Streben nach Gesundheit,
als Spiegelbild des rechten harmonischen Weges, stellten taoistische Schulen
schon sehr früh ein Bestreben in den Vordergrund: ein langes Leben, mit dem Ziel
der Unsterblichkeit. Neben geistig-körperlichen Übungen, Meditation und Methoden
der "inneren Alchemie", sollte dieses Vorhaben durch Einnahme
lebensverlängernder Substanzen erreicht werden. Viele Pflanzen haben die
chinesischen Weisen im Lauf von Jahrtausenden dafür erprobt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Glieder von zu Brei gekochten Kindern, Fett, Blut,
Herzen ungetaufter Kinder, giftige Schlangen, Eidechsen, Spinnen, eine mit einer
geweihten Hostie gefütterte Kröte, gepulverte Knochen eines Gehängten und ein
ganzes Arsenal an giftigen Kräutern sollen die Hexen,
glaubt man den zeitgenössischen Berichten, gemischt haben, um daraus unter
Anleitung des Teufels ihre Hexensalbe zu gewinnen.
Mit diesem Hexengebräu hätten sie Gesicht, Körper oder einen Stab bestrichen und
sich daraufhin in die Lüfte erhoben, um zum Hexensabbat zu fliegen.
Doch gab es diese Salben wirklich ?
Die Hexen waren vor allem "wissende Frauen", Pflanzenkundige. Sie wussten
gefährliche und mächtige Pflanzen zum Heilen und zur Bewusstseinsveränderung
anzuwenden. Sie haben zweifellos Nachtschattengewächse und andere psychoaktiv
wirkende Pflanzen eingenommen.
Vielleicht haben sie auch tatsächlich Salben aus solchen Pflanzen hergestellt -
allerdings ohne die fantastischen und abstoßenden Zutaten, deren Verwendung
ihnen ihre Verfolger unterstellten.
Möglicherweise gehen die Bestandteile der Hexensalbe auf eine Tradition der
Antike zurück. Es gibt Hinweise darauf, dass sich die wilden Mänaden zu ihren
heiligen Orgien des Dionysos-Kultes mit Fliegenpilz, Tollkirschen oder
Bilsenkraut berauschten. Sie sollen sich mit weit aufgerissenen Augen in die
Arme ihres Gottes geworfen haben, was eine Folge der Einnahme von Tollkirschen
sein könnte.
Die italienischen Gelehrten Geronimo Cardano (Hieronymus Cardanus) und
Giambattista della Porta (1538-1615) berichteten als erste ausführlich über die
Hexensalbe. Es war die Zeit aufstrebender Wissenschaften, und man erkundete
experimentell die Wirkung von psychoaktiven Kräutern. Dadurch gelangten Cardano
und Porta zu einer "Halluzinationstheorie" des Hexenfluges. Durch die
psychotropen Wirkung der verwendeten Pflanzen käme es zu einer Illusion eines
Fluges.
Wagemutige Wissenschaftler führten Selbstversuche mit Hexensalben durch.
Der französische Mathematiker Pierre Gassendi (1592-1655) war einer der Ersten.
Er experimentierte mit einer opiumhaltigen Salbe und berichtet von lebhaften
Flugvisionen.
Im 20. Jahrhundert war es der Göttinger Volkskundler Will-Erich Peuckert, der
sich
mit einer Hexensalbe aus Bilsenkraut, Stechapfel, Sturmhut, Tollkirsche und Mohn
nach einem Rezept von Giambattista della Porta einrieb und darüber berichtet:
"Vor meinen Augen tanzten zunächst grauenhaft verzerrte menschliche Gesichter.
Dann plötzlich hatte ich das Gefühl, als flöge ich meilenweit durch die Luft.
Der Flug wurde wiederholt durch tiefe Stürze unterbrochen. In der Schlussphase
sah ich schließlich das Bild eines orgiastischen Festes mit grotesken sinnlichen
Ausschweifungen."
Auch der Biologe Wilhelm Mrsich, der bereits in den 30er Jahren des letzten
Jahrhunderts mit verschiedenen Rezepturen für eine Hexensalbe experimentierte,
erlebte bei einem Selbstversuch eine Begegnung mit Teufelsgestalten und
wollüstigen Halluzinationen, die er mit dem sinnlichen Erlebnis Tannhäusers im
Venusberg verglich, und schließlich sogar einen Flug zu einer Hexenorgie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Eisenhut
Eisenhut
Bestandteil vieler Hexensalben war auch die äußerst giftige Pflanze Sturmhut
(auch Eisenhut, Aconitus napellus). Sie enthält das Alkaloid Aconitin, eines der
stärksten Gifte der Pflanzenwelt, das besonders stark konzentriert in der
Wurzelknolle vorhanden ist. Der Sage nach entstand der Sturmhut aus dem Geifer
des Höllenhundes Kerberos, als ihn Herakles am Hügel Akonitos in Pontos aus der
Unterwelt hinaufzerrte.
Im Mittelalter pflanzte man den Sturmhut in Klostergärten. Laut Albertus Magnus,
deutscher Philosoph und Theologe (1193-1280), hilft das Kraut gegen Lepra. Der
Arzt und Alchemist Paracelsus (1493/94-1541) setzte es als Abführmittel ein.
Heute wird der
Sturmhut unter seiner lateinischen Bezeichnung Aconitum als homöopathisches
Mittel verwendet, vor allem bei seelisch-geistigen Beschwerden wie Ängsten und
Phobien.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

An verborgenen Plätzen wächst der mythische Hexer
Kiéri Tewiyari als Pflanze. Er hat sich trichterförmige Blüten zugelegt und
runde, dornenbedeckte Samenblätter. Isst ein Unglücklicher von dem verbotenen
Baum, so wird er mit Wahnsinn und Tod geschlagen. Er glaubt, ein Vogel zu sein
und springt vom Felsen.
Diese Geschichte erzählen die Huichol-Indianer in Westen Mexikos, die um die
gefährliche magische Macht des Stechapfels (Datura) wissen.
Verwandt mit der Datura sind die Brugmansia-Arten im westlichen Südamerika, die
sogenannten Engelstrompeten. Neuere Forschungen ergaben, dass man Brugmansia
besser einer eigenen Gattung zuordnet.
Der älteste Bericht über die rituelle Einnahme von Brugmansia stammt von dem
Forschungsreisenden Johann von Tschudi (1818-1889) aus dem Jahr 1846. Er
beschreibt die physiologischen Reaktionen und die Verhaltensänderungen unter der
Einwirkung der Pflanze, die stets eine Phase höchster Erregung auslöst.
In vielen Kulturen in Amerika, Europa und Asien war und ist der Stechapfel als
besonders mächtige Zauberpflanze bekannt. Wegen der Heftigkeit der durch sie
hervorgerufenen Bewusstseinsveränderungen wird die Pflanze in einigen Kulturen
mit bösen Zauberern in Verbindung gebracht wird.
Die südamerikanischen Jivaro-Indianer am Amazonas warnen vor dem Gebrauch des
Stechapfels, außer für die wichtige und gefährliche Initiation der Krieger.
Als Heilpflanze wird der Stechapfel allerdings geschätzt. Wie die Zuñi und
Azteken in der Neuen Welt, so verwenden auch die afrikanischen Zulu die Pflanze
in Salbenform als Schmerzmittel und zur Behandlung von Knochenbrüchen.
Das gewöhnliche Leben ist eine Illusion. Die wahren Kräfte hinter den
alltäglichen Erscheinungen sind übernatürlicher Natur. Davon sind die
Jivaro-Indianer überzeugt. Ihre Schamanen versetzen sich mit psychotropen
Pflanzen in Bewusstseinszustände, in denen sie mit vermeintlichen Göttern und
Dämonen um das Leben ihrer Patienten feilschen.
Mit sechs Jahren wird ein Jivaro-Junge von seinem Vater an einen heiligen
Wasserfall geführt. Dort baden sie und nehmen einen Saft von Engelstrompeten (Brugmansia)
zu sich, damit der Sohn eine "äußere Seele" bekommt. Die Jivaro nennen sie "die
Visionen erzeugende Seele" (arutam wakani), denn sie allein ermöglicht eine
Verbindung zu den Ahnen.
Diese "arutam" dringt im Brugmansia-Rausch in Gestalt eines Jaguars oder einer
Anakonda in den Körper des Knaben ein.
Im kolumbianischen Andental von Sibundoy wird dem Rausch mit einem Sud der
Engelstrompete sehr häufig gehuldigt. Die Schamanen dieser Region haben
außerordentliche Kenntnisse über die Wirkungen dieser Pflanze gewonnen, die sie
bei verschiedensten Krankheiten einsetzen können.
Es gibt jedoch unberechenbare und äußerst unangenehmen Neben- und Nachwirkungen
der Brugmansia, wie Wutanfälle oder vorübergehender Wahnsinn.
In Mittelamerika ist der Stechapfel heimisch und schon seit langem in
schamanischem Gebrauch. Auch in Südamerika, entlang der Anden von Kolumbien bis
Chile lässt sich seine Verwendung bis in präkolumbianische Zeiten belegen, denn
schon die Inka und Chibcha haben die südamerikanische Küstendatura, die dort als
Baum wächst, rituell benutzt. Durch Normadenvölker, Zigeuner aber auch durch
mexikanischen Import wurde die Pflanze in Europa heimisch.
Der Name Datura für stammt aus dem Sanskrit. Als "dhat" bezeichnete man ein
Gift, das aus einer Stechapfelart gewonnen wurde. Die psychotropen Bestandteile
dieser Art
von Nachtschattengewächs sind die Tropan-Alkaloide Hyoscyamin, Scopolamin und
Atropin. Der Alkaloidgehalt ist in den Blüten am geringsten.
In hohen Dosen ist die Wirkung stark berauschend. Überdosierungen können
Tobsucht und Halluzinationen hervorrufen und im schlimmsten Fall zum Tod durch
Atemlähmung führen. Die pharmakologisch wirksamen Bestandteile sind vielfältig,
so dass Datura zurecht bei vielen Stämmen als wichtiges Arzneimittel galt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Fliegenpilze
Fliegenpilze
Kerzen erleuchten die kleine Hütte der Pilz-Heilerin
in den mexikanischen Bergen.
María Sabina beginnt ihre magische Zeremonie mit den heiligen Pilzen.
Über dem Räucherharz schwenkt die Indianerin paarweise die Pilze, die sie
liebevoll "niños santos", heilige Kinder, nennt. Drei Paar bekommt ihre
schwerkranke Schwester, sie selbst nimmt eine weit größere Menge dieser sakralen
Speise zu sich. Allmählich beginnt sie mit großer Leichtigkeit zu sprechen. Die
Pilze bringen ihr schönen Gesang und geben Ratschläge. Die berühmte
Pilz-Heilerin sagte einmal: "Der Pilz ähnelt deiner Seele. Er führt dich
dorthin, wohin die Seele gehen will. Aber nicht jeder tritt in die Welt ein, in
der alles bekannt ist."
Schon die Azteken erzählten, dass die Pilze durch Blutstropfen des Gottes
Quetzalcoatl ( "Gefiederte Schlange") sprießen. Sie nannten den Pilz Teonanácatl
("Fleisch Gottes").
In mexikanischen Chroniken des 16. und 17. Jahrhunderts wird die Verwendung von
Pilzen als Rauschdrogen belegt.
Bereits 1569 beschreibt der mexikanische Schriftsteller Fray Toribio de
Benavente (1490-1569; Pseudonym: Motolina) in seiner "Historia de los Indios de
la Nueva España" die Einnahme der Pilze während religiöser Zeremonien: "Als
Erstes aß man während des Festes kleine schwarze Pilze, Nanacatl genannt, die
einen trunken machen, Visionen und selbst Wollust hervorrufen. Sie aßen sie, ehe
der Tag anbrach ... mit Honig und sobald sie sich durch ihren Einfluss genug
erhitzt fühlten, begannen sie zu tanzen... Diese setzten sich in einen Raum, wo
sie versunken blieben. Die einen hatten das Gefühl, sie stürben, und weinten in
ihren Halluzinationen, andere sahen sich von einem wilden Tier aufgefressen,
wieder andere bildeten sich ein, sie nähmen einen Feind im Kampfgetümmel
gefangen..."
Motolina berichtete auch über die Symptome, die mit dem Verzehr der Pilze
einhergehen: So wird der "erhitzte" Zustand wird durch einen vermehrten
Blutandrang, vor allem im Gesicht, hervorgerufen, der auf der Wirkung des
enthaltenen Psilocybins beruht.
Auch bei der Krönungszeremonie des Montezuma - so berichten die Historiographen
- wurden als Bestandteil der Feier von allen Teilnehmern rohe Pilze verzehrt,
"die sie betrunkener machten als viel Wein"
Als heiliger Pilz wird in Mexiko neben Psilocybe, Conocybe und Panaeolus auch
der Hongo de San Isidrio (Stropharia cubensis) verwendet, den die Mazateken als
"göttlichen Dungpilz" bezeichnen. Die verschiedenen Pilze werden zur
zeremoniellen Weissagung und zum Heilen benutzt. In früherer Zeit muss auch der
Fliegenpilz unter den Maya in kultischer Verwendung gestanden haben. Noch heute
assoziieren die Quiche-Maya in Guatemala den Fliegenpilz mit Erleuchtung, denn
sie nennen ihn cakuljá ikox, "Pilz des Blitzes".
Die jahrhundertealte Tradition des Pilzkultes beweisen zahlreiche kleine
Skulpturen, die man in Mittelamerika ausgegraben hat. Sie zeigen Pilze, die aus
menschlichen und tierischen Wesen zu wachsen scheinen. Die ältesten stammen aus
dem zweiten Jahrtausend vor Christus, der präklassischen Periode der Maya. Auf
Keramikgefäßen der peruanischen Moche-Indianer kann man Personen erkennen, bei
denen ein Trichter als Fortsatz aus der Stirn ragt. Man hat die Vermutung
geäußert, dass es sich dabei um einen Pilz handelt: eine symbolische Darstellung
für die geistige Erfahrung im Pilzrausch.
Fast alle Arten der heiligen Pilze Mittelamerikas enthalten die zwei Wirkstoffe
Psilocybin und Psilocin. Der Hauptwirkstoff ist das Psilocybin. Es handelt sich
dabei um die organische Verbindung des Phosphorsäureesters, von Psilocin, von
dem nur Spuren in den Pilzen vorhanden sind. Psilocybin und Psilocin gehören zur
großen Klasse der Indolalkaloide und weisen eine auffallende Ähnlichkeit mit
Serotonin auf - einem so genannten Neurotransmitter, der bei der
Reizübermittlung von Nerv zu Nerv eine wichtige Funktion besitzt.
Die Schamanen zahlreicher sibirischer Stämme verwenden den Fliegenpilz (Amanita
muscaria) für Heilséancen und für die Kommunikation mit der Geisterwelt.
Im Fliegenpilzrausch hört der Schamane die Stimme des Pilzes. Alles erscheint
ihm riesengroß oder schrecklich klein. Bald verliert er die Kontrolle über
seinen Körper und verfällt in Zerstörungswut. Flugerlebnisse folgen, der Heiler
besucht andere Welten. Schließlich folgt die Erschöpfung und er sinkt in einen
tiefen Schlaf.
Der Fliegenpilz wurde in Sibirien meist in getrocknetem Zustand eingenommen. Die
Wirkstoffe im Fliegenpilz sind Ibotensäure und das Alkaloid Muscimol. Wird der
Pilz getrocknet, kommt es zum Umwandlung der Ibotensäure in Muscimol, was die
psychedelische Wirkung des Pilzes noch erhöht.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Es gibt in Mexiko eine Schlingpflanze, die aufgrund
ihrer pfeilförmigen Blätter auch Pfeilkraut genannt wird. Wenn die Priester der
Indianer mit den Geistern Verstorbener in Kontakt treten wollen, genießen sie
von diesen Samen, um sich sinnlos zu berauschen, und sehen dann Tausende von
Teufelsgestalten und Fantasmen um sich."
So lautet die erste Beschreibung von Ololiuqui in der monumentalen
Naturgeschichte Neuspaniens des Arztes Francisco Hernandez, der schon von 1570
bis 1575 in Mexiko Studien betrieb.
Die Indianer zermahlen die Samen der Windenpflanze Ololiuqui zu einem
mehlartigen Pulver. Für kurze Zeit geben sie dieses Mehl in kaltes Wasser, das
sie anschließend durch ein Tuch rinnen lassen und trinken. In der frühen Zeit
der Missionierung wurden Besitzer von Ololiuqui grausam verfolgt und bestraft.
Ruiz de Alarcón beschrieb 1629 in seinem Traktat über den Aberglauben der
Eingeborenen von Neuspanien den Gebrauch des Ololiuqui als eine Art Orakel, mit
dem die Indianer Zwiesprache halten würden. Nach Einnahme des Tranks ziehe sich
der Indianer aus der Dorfgemeinschaft zurück. Niemand dürfe sich ihm nähern,
denn ein Dämon würde in dem Samen stecken, der nach der Einnahme herauskomme.
Nur alleine könne der Indianer den Dämon befragen und so verlorene Gegenstände
wieder aufspüren und die Zukunft ergründen. Heute verwenden die Maya auf der
mexikanischen Halbinsel Yucatán die Samen unter dem Namen Xtabentum
(Edelsteinkordel). Verliert jemand etwas Wertvolles, dann erhält er Xtabentum
zum Trinken. Vor dem Einschlafen wird ihm ins Ohr geflüstert, wie der Gegenstand
aussieht, den er im Schlaf finden soll. Ist der Schlaf seicht, gibt er
Antworten, wie ein Hypnotisierter.
Die chemische Struktur von Ololiuqui entschlüsselte der Entdecker der
synthetischen Droge LSD, der Schweizer Chemiker Dr. Albert Hofmann.
Die Samen von Turbina corymbosa und von Ipomoea violacea enthalten die Alkaloide
d-Lysergsäureamid und d-Isolysergsäureamid, die große Ähnlichkeit mit LSD
aufweisen.
Die Ipomoea-Samen haben einen größeren Prozentualanteil an Alkaloiden. Deshalb
verwenden die Indianer davon Mengen als von den Samen der Turbina.
Es besteht kein Zweifel, dass die in den Pflanzen enthaltenen Lysergsäureamide
sowie Elymoclavin und das Lysergol für die psychotropen Wirkungen verantwortlich
sind.
Ähnlich wie beim LSD sind die Reaktionen auf die Einnahme von Ololiuqui sehr
unterschiedlich: Es kann neben angenehmen Eindrücken auch zu sehr beängstigenden
Sinnestäuschungen und Rauschzuständen führen. Wie bei allen Drogen besteht das
Risiko der psychischen Abhängigkeit und vor allem auch die Gefahr von
lebensgefährlichen oder tödlichen Unfällen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 San-Pedro
San-Pedro
Im Alten Tempel von Chavín de Huantar im nördlichen
Hochland von Peru entdeckten Archäologen ein eindrucksvolles Steinrelief. Es
zeigt die Hauptgottheit von Chavín: ein menschenähnliches Wesen mit einem
Jaguarkopf. In einer Hand hält er San-Pedro-Kaktus. Das Relief entstand etwa
1300 v. Chr. - ein Beweis für die lange Tradition des Kultes um das drei bis
sechs Meter hohe Gewächs.
Kakteen sind bei den Indianern Südamerikas noch immer Geschenke der Götter:
selbst unter extremsten Bedingungen ist ihr Gedeihen kein Problem.
Dass einige von Ihnen zu den Halluzinogenen zählen und ihre Einnahme
rauschähnliche Zustände bewirkt, ergibt für die Ureinwohner Sinn: so erhält man
Kontakt zur mystischen Anderswelt, aus der man Kraft beziehen, Rat holen und
medizinisches Wissen weitergeben kann.
Im Reich der Moche-Indianer, die in der Zeit von 200 bis 800 n. Chr. im
nördlichen Hochland Perus lebten, spielte der halluzinogene Kaktus eine zentrale
Rolle im Rahmen eines Hirschkults.
Auch die spanischen Missionare konnten das "Teufelsgetränk" nicht verdrängen.
Zu den ursprünglichen indianischen Mythen kamen lediglich christliche Elemente
hinzu.
Bis heute ist der Kaktus in den Anden ein Heilmittel.
Für magische Rituale und Heilungen, zur Wahrsagerei, gegen Hexerei und zum Lösen
von Verzauberungen wird ein Sud der Kakteen eingenommen.
Gesammelt wird der San Pedro vornehmlich in den hohen Andenregionen.
Zu dieser Gelegenheit veranstalten die Schamanen eine Wallfahrt.
Büßer können hier bei einem Bad Wandlung erfahren, denn die Einnahme des
Kakteen-Suds in dieser Gegend gilt als besonders wirkungsvoll.
Das wichtigste, bis heute praktizierte des Kaktus-Kults ist das so genannte
Mesa-Ritual.
Ein Tisch wird von Holzstangen und Säbeln begrenzt. Dazwischen liegt ein
Sammelsurium von magischen Gegenständen auf einem Tuch. Der Säbel und Stock
sollen dabei den Tisch, die Mesa, vor den Angriffen feindlicher Hexer schützen.
Die magischen Utensilien haben alle eine bestimmte Bedeutung, sind im Weltbild
der Heiler lebendig und können bei richtiger Anwendung ihre positiven Energien
zum Wohl von Kranken entfalten.
Die Mesa ist ein symbolisches Abbild der Lebenswelt und Grundlage dieser
speziellen Form der schamanischen Heilungspraxis.
Bisweilen werden Reinigungsmixturen aus verschiedenen Kräutern eingenommen.
Meist erhalten die teilnehmenden Indianer, eine braune Brühe zum Trinken: den
San-Pedro-Tee.
Er wird aus einem siebenzackigen Kaktus gekocht, nur so ist er wirksam.
Vor einer Ansammlung magischer Utensilien schlägt der Schamane eine Rassel, um
die Geister anzulocken. Später wird eine Art Nest aus Kokablättern hergestellt,
auf das Stücke von Lamafett und zahlreiche andere landwirtschaftliche Produkte
kommen, schließlich wird Zuckerrohrschnaps als Trankopfer gegeben. Gebete
begleiten die Handlungen. Häufig wird noch ein bitterer Sud aus Tabak und
Zuckerrohrschnaps verteilt. Das soll die Stimmung heben und Glück bringen.
Dann folgen die eigentlichen Heilungshandlungen, die mit Hilfe von Holzstäben,
Feuersteinen, magischen Objekten und mystischen Sprüche durchgeführt werden. Bis
ins Morgengrauen kämpft der Schamane auf diese Weise mit imaginären angreifenden
Hexern, die für viele Krankheiten seiner Patienten verantwortlich sein sollen.
Chemisch betrachtet ist das Gemisch an Alkaloiden im San-Pedro-Kaktus ähnlich
dem Peyote-Kaktus, einer Kakteenart, die ebenfalls bewusstseinserweiternde
Inhaltsstoffe enthält. Der Hauptbestandteil für die halluzinogene Wirkung ist
das Meskalin. Auch eine Reihe anderer Alkaloide, wie 3-Methoxy-Tryamin und
3,4-Dimethoxyphenyläthylamin, konnten nachgewiesen werden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Ayahuasca
Ayahuasca
Es ist Nacht. Tief im Dschungel des westlichen
Amazonasbeckens öffnen sich zum Gesang des Schamanen die Tore zu einer
unsichtbaren Welt. Eine kleine Gruppe Shipibo-Indianer hat Ayahuasca zu sich
genommen, ein Gebräu aus einer Lianenart (Banisteriopsis) und anderen
halluzinogenen Pflanzen. Ein Heilritual findet statt.
Kranke behandelt der Schamane im Rausch des Ayahuasca-Geistes. In seinem
psychedelischen Kosmos erfährt er den Grund für die Krankheit und beschwört die
krankheitserregende Schlange im Leib des Patienten.
Wo es schmerzt, bläst er den Rauch seiner Pfeife darüber. Die Krankheit saugt er
aus dem Körper und entfernt sie durch lautes Ausspucken.
Für den Behandlungserfolg entscheidend ist auch die Anwesenheit der Angehörigen
- und zwar nicht nur für den Patienten. Denn Heilung erfahren auch Gesunde durch
die Erneuerung der Verbindung zu Natur, Kosmos und Mitmenschen. Zum Klang von
Rasseln leitet der Schamane in seinen Gesängen die Teilnehmer durch die
psychedelische Erfahrung.
"Liane der Seelen" wird diese mächtige Pflanze in der Quechua-Sprache der
prähispanischen Inkas von Peru genannt.
Die Wirkstoffe der Urwaldliane Banisteriopsis gehören zur Stoffklasse der
Indolalkaloide. Um die rituellen Getränke zu bereiten, mischen die Indianer in
den verschiedenen Regionen unterschiedliche Arten von Banisteriopsis und geben
andere psychoaktive Pflanzen hinzu, meist Nachtschattengewächse, wie etwa die
Stechapfelart Datura suaveolens oder die Blätter der Pflanze Psychotria viridis,
die DMT (Dimethyltryptamin) enthalten.
Der Sud aus der Urwaldliane steht bei vielen Stämmen in Kolumbien, Ecuador,
Brasilien und Peru unter verschiedenen Namen in höchstem Ansehen. Nicht zuletzt
durch die US-amerikanischen Schriftsteller William S. Burroughs und Allen
Ginsberg wurde Ayahuasca in der westlichen Kultur bekannt. Eines der wichtigsten
Alkaloide der Liane wurde früher als Telepathin bezeichnet, weil Yagé, wie die
Lianenart auch genannt wird, telepathische Fähigkeiten begünstigen soll.
Im Yagé-Rausch sehen die Schamanen Dinge, die sich in der Ferne ereignen, sie
senden ihre Krafttiere, etwa den Jaguar, zu Kämpfen mit Hexern aus, erleben
Tierverwandlungen und unternehmen Flüge in weit entfernte Regionen oder in
Gebiete, die unserer alltäglichen Wahrnehmung nicht zugänglich sind.
Der Ayahuasca-Rausch regt auch die kreativen Fähigkeiten an. Die von rhythmisch
wiederkehrenden Mustern begleiteten Visionen einer intensiv belebten Geisterwelt
stellen die Indianer als Ornamente dar, in der sich die ethnische Gruppe
wiedererkennt.
Diese stammesspezifischen künstlerischen Motive schmücken Umhänge, Tonkrüge,
Hüttenfassaden, Masken und Gesichter.
Aber auch viele der amerikanischen Künstler der so genannten Beat Generation
experimentierten in den späten 50er und 60er Jahren mit der Droge, die sie in
ihrer Kreativität beflügelt haben soll.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unter Fo Ti Teng werden heute zwei Pflanzen
verstanden. Einmal Hydrocotyle asiatica minor, die in der traditionellen
indischen Medizin, dem Ayurveda, wie auch in China zur Erhöhung der geistigen
Klarheit und für Langlebigkeit verwendet wird. Andererseits Polygonum
multiflorum, das als Fo Ti Teng oder Ho Shou Wu bekannt ist. Einer Legende
zufolge entdeckte ein gewisser Ho Shou Wu ("Mann mit schwarzen Haaren") im Alter
von 60 Jahren, als er ausgebrannt, impotent und dem Alkohol verfallen war,
zufällig die Pflanze. Er nahm sie von da an regelmäßig ein, zeugte vier Kinder
und starb mit 132 Jahren. Die Pflanze erhielt seinen Namen. Wissenschaftliche
Untersuchungen haben gezeigt, dass Polygonum multiflorum durch das in der Wurzel
gefundene Lecithin den Cholesterinspiegel senken kann und gegen Schlaflosigkeit
und Haarausfall wirkt.
Hsien nennt man in China Männer und Frauen, die das Lebenselixir gleichsam in
sich tragen und die Unsterblichkeit erlangt haben. Man kennt drei Kategorien
Hsien: himmlische Unsterbliche (Tian Hsien), irdische Unsterbliche (Ti Hsien)
und Verstorbene, die als körperlose Wesen weiter existieren (Shi Chieh Hsien).
Eine beliebte Darstellung ist das Fest der acht Unsterblichen (Pa Hsien), bei
dem sie auf einer Terrasse den Gott der Langlebigkeit Shou-hsing begrüßen, der
auf einem Kranich geflogen kommt. Der Palast von Shou-hsing ist von einem Garten
mit Kräutern umgeben, in dem auch das Kraut der Unsterblichkeit wächst.
Den Taoisten zufolge besitzt Ginseng (Panax ginseng) mehr als jede andere
Pflanze die Fähigkeit, die Lebensenergie Qi der Erde in seiner Wurzel zu
konzentrieren. Deshalb vermag sie die "drei Schätze des Menschen" - die
feinenergetische Essenz (Jing), die Lebensenergie (Qi) und die geistige Energie
(Shen) - auf diesen zu übertragen. Ihre verjüngende Wirkung zeige sich auch
darin, dass die Ginseng-Wurzel wie die Figur eines kleines Kindes aussehe. In
den Wundergeschichten, die um Ginseng erzählt werden, spielt immer ein Kind die
Hauptrolle.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Zurück
Zurück